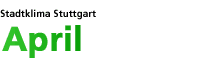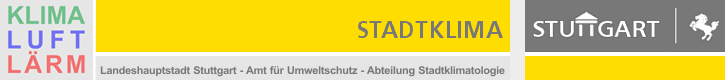Grundlagen zu Lärm und Lärmschutz Grenzwerte für Verkehrslärm
Grenzwerte für Verkehrslärm
Zum Schutz der Bevölkerung vor Verkehrslärm existieren
verschiedene Grenz-, Richt- und Orientierungswerte, die jeweils ihren
spezifischen
Anwendungsbereich haben. Nachfolgend gibt die Tabelle einen Ãberblick:
|
Gebietsart
|
Neubau oder wesentliche Ãnderung von StraÃen
und Schienen- wegen
|
Schallschutz im Städtebau
|
Lärm- sanierung an bestehenden StraÃen
|
Verkehrs- beschränk- ungen in bestehenden
StraÃen
|
|
|
Grenzwerte der
16. BImSchV
|
Orientierungs- werte der
DIN 18005
|
Auslösewerte der
VLärmSchR 97
|
Richtwerte der Lärmschutz- Richtlinien- StV
|
| |
Tag / Nacht |
Tag / Nacht |
Tag / Nacht |
Tag / Nacht |
| Gewerbegebiete
|
69 / 59 |
65 / 55 |
72 / 62 |
75 / 65 |
|
Kerngebiete |
64 / 54 |
63 / 53 |
66 / 56 |
72 / 62 |
| Urbane
Gebiete |
64 / 54 |
60
/ 50 |
66 / 56 |
72 / 62 |
| Dorf-
und Mischgebiete |
64 / 54 |
60 / 50 |
66 / 56 |
72 / 62 |
|
Besondere Wohngebiete |
64 / 49 (1) |
60 / 45 |
66 / 54 (1) |
72 / 60 (1) |
|
Allgemeine Wohngebiete |
59 / 49 |
55 / 45 |
64 / 54 |
70 / 60 |
|
Kleinsiedlungsgebiete |
59 / 49 |
55 / 45 |
64 / 54 |
70 / 60 |
|
Reine
Wohngebiete |
59 / 49 |
50 / 40 |
64 / 54 |
70 / 60 |
Krankenhäuser,
Schulen, Kurheime, Altenheime |
57 / 47 |
45 - 65 /
35 - 65 (2) |
64 / 54 |
70 / 60 |
|
Parkanlagen, Kleingartenanlagen |
- |
55 / 55 |
- |
- |
Tag 06.00 -
22.00 Uhr, Nacht 22.00 - 06.00 Uhr
(1) nicht gesondert aufgeführt, Einstufung
daher analog zur DIN 18005 wie
Mischgebiete (tagsüber) bzw. Allgemeine Wohngebiete (nachts)
(2) Sonstige Sondergebiete, soweit sie
schutzbedürftig
sind; je nach Nutzungsart
festzulegen
Für Industriegebiete gibt es keine Immissionsgrenzwerte. |
Tabelle: Grenz-, Richt- und Orientierungswerte beim Verkehrslärm
in dB(A)
 Neubau oder wesentliche Ãnderung von StraÃen und Schienenwegen: Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV)
Neubau oder wesentliche Ãnderung von StraÃen und Schienenwegen: Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV)
Beim Neubau oder einer wesentlichen Änderung einer Straße
oder eines Schienenweges gilt die Verkehrslärmschutzverordnung (16.
BImSchV). Die Änderung ist wesentlich, wenn
1. eine Straße oder ein Schienenweg um einen oder
mehrere durchgehende Fahrstreifen bzw. Gleise baulich erweitert wird oder
2. âdurch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel
des von dem zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms
um mindestens 3 dB(A) oder auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens
60 dB(A) in der Nacht erhöht wirdâ (§ 1 Abs. 2 Satz 2) oder
3. der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden
Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms von mindestens 70 dB(A) am Tag
oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht durch einen erheblichen baulichen
Eingriff erhöht wird.
Aus diesen Sätzen geht hervor, dass die 16. BImSchV
nur bei größeren baulichen Veränderungen gilt. Veränderte
Ampelschaltungen oder kleinere Baumaßnahmen wie z.B. das Anlegen
einer Verkehrsinsel stellen keine wesentlichen Änderungen dar. Weiter
gilt die 16. BImSchV auch nicht bei einer erhöhten Lärmbelastung
durch die Zunahme des Verkehrs.
Die 16. BImSchV setzt zum Schutz der Nachbarschaft vor
âschädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräuscheâ Grenzwerte
fest. Im Gegensatz zu den anderen Richtlinien zum Verkehrslärmschutz
haben die betroffenen Bürger hier einen Rechtsanspruch auf Einhaltung
der Grenzwerte. Der Straßenbaulastträger bzw. der Schienennetzbetreiber hat nur den Ermessensspielraum,
auf welche Weise die Grenzwerte eingehalten werden. Es gilt aber der Grundsatz
âaktiv vor passivâ. Das heißt, der Baulastträger ist verpflichtet,
zunächst durch geeignete Trassenführung und Lärmschutzbauwerke
am Verkehrsweg (Lärmschutzwände oder -wälle, Einhausungen, leisere StraÃenbeläge)
die Einhaltung der geforderten Grenzwerte anzustreben. Nur wenn die Kosten
dieser Maßnahmen (bzw. Mehrkosten bei größerer Dimensionierung
der Lärmschutzbauwerke) außer Verhältnis zum zusätzlichen Nutzen
stehen (§ 41 Abs. 2 BImSchG), kommen passive Lärmschutzmaßnahmen
an den zu schützenden Gebäuden selbst (Lärmschutzfenster,
schallgedämmte Lüftungseinrichtungen) in Betracht. Können
schützenswerte Außenbereiche (Terrassen, Balkone) durch Lärmschutzbauwerke nicht
ausreichend geschützt werden, sind Entschädigungen in Geld zu
leisten.
 Bauleitplanung: Schallschutz im Städtebau (DIN 18005)
Bauleitplanung: Schallschutz im Städtebau (DIN 18005)
In der Bauleitplanung (Aufstellung von Bebauungsplänen)
werden die Orientierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau)
zur Beurteilung der Lärmbelastung herangezogen. Wie der Begriff âOrientierungswerteâ
bereits aussagt, dienen sie der Orientierung und sind keine zwingend einzuhaltenden
Grenzwerte. Sie bieten einen Anhalt dafür, wann der Lärmschutz
ein wichtiger Abwägungssachverhalt darstellt, der bei der Abwägung
der verschiedenen öffentlichen und privaten Belange (u.a. gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse, soziale und kulturelle Bedürfnisse
der Bevölkerung, Belange des Umweltschutzes, Belange der Wirtschaft)
gegen- und untereinander angemessen zu berücksichtigen ist.
Der Schallschutz ist als ein wichtiger Planungsgrundsatz
neben anderen Belangen zu verstehen. Die in der städtebaulichen Planung
erforderliche Abwägung der Belange kann in bestimmten Fällen
bei Überwiegen anderer Belange - insbesondere in bebauten Gebieten
- zu einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen.
In diesen Fällen sollte möglichst ein Ausgleich durch andere
geeignete Maßnahmen (z.B. Grundrissgestaltung, baulicher Schallschutz)
vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.
Die erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen werden
im Bebauungsplan festgesetzt. Diese Maßnahmen sind in der Regel Lärmschutzwände
oder -wälle, nicht bebaubare Flächen zur Wahrung eines Abstands
von Lärmquellen und Maßnahmen an den Gebäuden selbst (Schallschutzfenster,
Grundrissgestaltung).
 Lärmsanierung an bestehenden StraÃen (VLärmSchR 97)
Lärmsanierung an bestehenden StraÃen (VLärmSchR 97)
An bestehenden Straßen besteht grundsätzlich kein
Rechtsanspruch auf Lärmschutzmaßnahmen. Maßnahmen können
hier als freiwillige Leistung auf der Grundlage haushaltsrechtlicher Regelungen
gewährt und im Rahmen der vorhandenen Mittel durchgeführt werden.
Die Voraussetzungen und Ausführungsbestimmungen
sind für Straßen in der Baulast des Bundes in den âRichtlinien
für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der
Baulast des Bundes - VLärmSchR 97â geregelt. Das Land Baden-Württemberg
hat sie für die Straßen in der Baulast des Landes ebenfalls
eingeführt und den Kreisen und Gemeinden empfohlen, entsprechend zu
verfahren.
Voraussetzung, dass bauliche LärmschutzmaÃnahmen (Lärmschutzwände oder -wälle, Einhausungen, lärmarme StraÃenbeläge) an bestehenden StraÃen durchgeführt werden, ist die Ãberschreitung der Auslösewerte für Lärmsanierung. Bei Einführung der VLärmSchR 97 im Jahr 1997 betrugen sie für Misch-, Dorf- und Kerngebiete noch 72 dB(A) tagsüber und 62 dB(A) nachts, für Wohngebiete, Schulen, Krankenhäuser und Altenheime 70 dB(A) tagsüber und 60 dB(A) in der Nacht. 2010 wurden die Auslösewerte um 3 dB(A), 2020 um weitere 3 dB(A) gesenkt, so dass heute die oben in der Tabelle genannten Werte gelten.
 Verkehrsrechtliche MaÃnahmen in bestehenden StraÃen: Lärmschutz-Richtlinien-StV
Verkehrsrechtliche MaÃnahmen in bestehenden StraÃen: Lärmschutz-Richtlinien-StV
Die Anwendung von Verkehrsbeschränkungen aus Lärmschutzgründen in bestehenden StraÃen wird in den âRichtlinien für straÃenverkehrsrechtliche MaÃnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV)â vom 23. November 2007 geregelt. Anordnungen zur Beschränkung des Verkehrs (Geschwindigkeitsbeschränkungen, Fahrverbote, ggf. nur für bestimmte Fahrzeugarten, z.B. Lkw) setzen voraus, dass die Tatbestandsvoraussetzungen des § 45 Abs. 9 StraÃenverkehrs-Ordnung (StVO) vorliegen. Danach dürfen entsprechende MaÃnahmen ânur angeordnet werden, wenn auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung ⦠erheblich übersteigtâ. MaÃgeblich ist, ob die Lärmbeeinträchtigung jenseits dessen liegt, was unter Berücksichtigung der Belange des Verkehrs im konkreten Fall als ortsüblich hingenommen werden muss und damit den Anwohnern zugemutet werden kann.
Nach neuerer Rechtsprechung kann eine solche Gefahrenlage bereits bei Ãberschreitung der Grenzwerte der 16. BImSchV (für StraÃenneubau) gegeben sein, da dann mit schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche zu rechnen ist. Werden diese Grenzwerte überschritten, haben die Lärmbetroffenen einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über eine verkehrsbeschränkende MaÃnahme. Als Orientierungshilfe für die Prüfung, wann verkehrsbeschränkende MaÃnahmen aus Gründen des Lärmschutzes âinsbesondere in Betrachtâ kommen, dienen die Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV (siehe Tabelle). Sind viele Menschen mit Lärmpegeln über den dort genannten Werten belastet, verdichtet sich das Ermessen in der Regel zu einer Pflicht zum Einschreiten. Auch dann kann jedoch von Verkehrsbeschränkungen abgesehen werden, wenn die damit verbundenen Nachteile zu groà sind und das qualifiziert belegt wird. Bei der Ermessensausübung ist jedoch besonders zu berücksichtigen, dass bei Lärmbelastungen ab 65 dB(A) tagsüber und 55 dB(A) in der Nacht mit einer Gesundheitsgefährdung (z.B. erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen) der betroffenen Bevölkerung gerechnet werden muss.
Bei der Abwägung, ob eine Verkehrsbeschränkung in Frage kommt, sind alle maÃgeblichen Aspekte zu prüfen: Verkehrsfunktion/-bedeutung der StraÃe, unerwünschte Verkehrsverlagerungen in andere StraÃen, die Belange des flieÃenden Verkehrs, Auswirkungen auf den Verkehrsfluss, den ÃPNV, den FuÃ- und Radverkehr, Auswirkungen auf die Lärm- und Luftschadstoffbelastung. Führen mildere Mittel wie z.B. eine Anpassung der Ampelsteuerung (Grüne Welle) zum gleichen Ziel, sind Verkehrsbeschränkungen nur noch schwer zu rechtfertigen.
Durch straÃenverkehrsrechtliche MaÃnahmen soll der Beurteilungspegel unter den Richtwert abgesenkt, mindestens jedoch eine Pegelminderung von 3 dB(A) bewirkt werden. Auch dieser Wert ist jedoch nicht als strikte Schranke zu verstehen, sondern als Anhaltspunkt dafür, wann eine MaÃnahme Gefahr läuft, für die begünstigten Anwohner kaum noch wahrnehmbar zu sein. In der Praxis kann z.B. das Problem einzelner lauter Vorbeifahrten durch Lkw von Bedeutung sein. Ein Lkw-Fahrverbot würde dann eine spürbare Entlastung für die Anwohner bringen, auch wenn sich das nicht entsprechend in der Senkung des Mittelungspegels niederschlägt. Auch wirksame Geschwindigkeitsbeschränkungen vermindern die Geräusche der einzelnen Fahrzeuge bei der Vorbeifahrt besonders stark. "Dies führt dazu, dass solche Geschwindigkeitsbeschränkungen von der betroffenen Bevölkerung positiver bewertet werden als dies im Rückgang des errechneten Lärmpegels zum Ausdruck kommt" (Ziffer 3.3 der Lärmschutz-Richtlinien-StV).
Geringere Pegelminderungen können auch das Ergebnis des Abwägungsprozesses sein. So ist z.B. auf einer innerstädtischen BundesstraÃe wegen Ãberwiegen anderer Belange (etwa wichtige überregionale Bedeutung der StraÃe im Verkehrsnetz) eine Anordnung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h anstatt auf 30 km/h trotz geringerer Lärmminderung möglich.
 Lärmsanierung an bestehenden Bahnstrecken
Lärmsanierung an bestehenden Bahnstrecken
Seit 1999 finanziert der Bund LärmsanierungsmaÃnahmen an den Schienenwegen des Bundes (an BundesfernstraÃen bereits seit 1978). Anfangs stellte der Bund dafür 51 Millionen Euro (damals 100 Millionen DM) jährlich bereit. Im Laufe der Jahre wurde das Fördervolumen immer wieder erhöht, so dass inzwischen 150 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung stehen.
Unter welchen Voraussetzungen der Bund LärmminderungsmaÃnahmen an bestehenden Eisenbahnstrecken finanziert, wird in der âRichtlinie zur Förderung von MaÃnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundesâ (neueste Fassung vom 6. Dezember 2018) geregelt. Danach fördert der Bund LärmminderungsmaÃnahmen, wenn die folgenden Auslösewerte für Lärmsanierung überschritten werden:
- für Krankenhäuser, Schulen, Kindertagesstätten, Kur- und Altenheime, reine und
allgemeine Wohngebiete 67 dB(A) am Tag/ 57 dB(A) in der Nacht,
- für Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 69 dB(A) am Tag / 59 dB(A) in der
Nacht,
- für Gewerbegebiete 72 dB(A) am Tag / 62 dB(A) in der Nacht.
Mit Ausnahme der Gewerbegebiete sind die Auslösewerte zurzeit also jeweils 3 dB(A) höher als bei der Lärmsanierung von StraÃen.
Die Deutsche Bahn AG erstellte eine Liste der Lärmsanierungsabschnitte mit Prioritätszahlen, die sich nach der Höhe der Lärmbelastung und der Anzahl der davon betroffenen Menschen richten. Da sich die Fördervoraussetzungen immer wieder ändern (höhere Lärmbelastungen aufgrund gestiegener Zugzahlen, gesenkte Auslösewerte usw.), wird diese Liste laufend aktualisiert und fortgeschrieben.
Bei der Durchführung orientiert sich die Deutsche Bahn AG weitgehend an der VLärmSchR 97. Die Entscheidung, ob aktive (i.d.R. Lärmschutzwände) oder passive MaÃnahmen (Schallschutzfenster) in Betracht kommen, erfolgt nach Nutzen-Kosten-Abwägungen.
In Stuttgart wurden an den Strecken Stuttgart - Ulm (Ortsdurchfahrten Bad Cannstatt, Untertürkheim und Obertürkheim), Stuttgart - Ludwigsburg (Ortsdurchfahrt Zuffenhausen), Untertürkheim - Kornwestheim (Ortsdurchfahrten Bad Cannstatt, Münster, Rot/Freiberg und Zazenhausen) und Kornwestheim - Korntal (Wohngebiete Salzweg und Elbelen) in den Jahren 2007 bis 2011 LärmschutzmaÃnahmen durchgeführt. Damals galten noch die Auslösewerte 75 dB(A) am Tag (70 dB(A) + 5 dB(A) Schienenbonus, der 2015 abgeschafft wurde) und 65 dB(A) in der Nacht (60 dB(A) + 5 dB(A) Schienenbonus). Aufgrund der mittlerweile abgesenkten Auslösewerte überprüft die Deutsche Bahn AG derzeit die bereits sanierten Streckenabschnitte, ob hier wegen der neuen Gegebenheiten weitere MaÃnahmen in Betracht kommen. Die Stadtteile Bad Cannstatt-Ost, Sommerrain (Strecke Stuttgart - Waiblingen) und Vaihingen (Gäubahnstrecke) befinden sich auf der Liste der noch zu sanierenden Abschnitte, allerdings mit einer relativ niedrigen Priorität.

| |

|
 |
|
| © Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz, Abt. Stadtklimatologie |